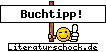Kaufen* bei
Amazon
Bücher.de
Buch24.de
* Werbe/Affiliate-Links
Da ich bei der Einzelkriterienliste für den SLW in einer Kategorie den Joker gezogen habe, eröffne ich also schon mal den Thread für die geforderten lektürebegleitenden Postings.
Klappentext: 1937, ein Jahr nach Beginn des Spanischen Bürgerkriegs. Francos Truppen haben das Baskenland erobert und machen wie überall mit den Anhängern der Republik kurzen Prozess. Mitten in der Nacht reißt das Säuberungskommando die Familie aus dem Schlaf. Als der Falangist Rogelio Cerón dem Lehrer und seinem ältesten Sohn die Hände auf den Rücken bindet, bleiben seine Augen an Gabino, dem Jüngsten, hängen. Unverwandt starrt der Kleine ihn an, sein Blick ist kalt und undurchdringlich. Eine unsagbare Wut steigt in Rogelio auf – doch der faschistische Ehrenkodex verbietet es ihm, ein Kind zu töten.
Der Falangist hat in diesem Bruderkrieg schon viele erschossen, Gabinos Blick lässt ihn dennoch nicht mehr los. Und so treibt es ihn noch einmal an den Ort, wo sie Vater und Sohn erschossen haben. Jemand hat den beiden ein Grab geschaufelt und darauf einen Schössling gepflanzt. Er reißt ihn heraus, aber in der folgenden Nacht ist ein neuer gepflanzt – und Gabino steht hinter ihm. Wortlos stellt der Zehnjährige dem Falangisten eine volle Gießkanne vor die Füße. Sein Blick ist unmissverständlich. Rogelio ahnt, dass sein Leben fortan vom Wachstum dieses Feigenbäumchens abhängt ...
Ramiro Pinilla gilt als einer der bedeutendsten baskischen Autoren der Gegenwart und hat mehrfach wichtige spanische Literaturpreise erhalten, so bereits 1960 den Premio Nadal sowie 2005 den Premio de la Crítica de narrativa castellana und 2006 den Premio Nacional de Narrativa. Nach Antonio Muñoz Molinas Die Nacht der Erinnerungen widme ich mich damit lektüremäßig erneut dem Spanischen Bürgerkrieg, diesmal aber nicht in Madrid und aus ganz anderer Perspektive. Ich bin schon sehr gespannt.