
Kaufen* bei
Amazon
Bücher.de
Buch24.de
* Werbe/Affiliate-Links
Inhalt: Karfreitag 1981. Rujen Keju bereitet sich auf seinen üblichen Arbeitstag in der Kläranlage von Kwajalein vor. Auf dem Weg zur Fähre, die ihn von Ebeye nach Kwajalein bringt, trifft er auf seine Söhne Jebro und Nuke, die den Tag auf Tar-Wōj, der Heimatinsel der Familie verbringen wollen. Das ist nicht erlaubt, die Amerikaner haben den Marshallesen den Zutritt auf die Insel verboten, allerdings ist Jebros Großvater dort beerdigt und er möchte seinem jüngeren Bruder etwas von dem vermitteln, was er selbst vom Großvater gelernt hat. Rujens Tag entwickelt sich nach der Auseinandersetzung mit seinen Söhnen nicht zum Besten: erst werden ihm auf der Fähre seine Arbeitsstiefel geklaut, dann findet er sein Fahrrad demoliert vor und kommt zu spät zum Dienst. Während des Tages erregen zwei Marshallesen Aufsehen unter den Amerikanern auf Kwajalein, weil sie Delphine gefangen haben. Die tierliebenden Amerikaner rufen daher sofort eine „Rettungsaktion“ ins Leben, um die Delphine vor dem Schlachten zu bewahren. Rujens Unglück an diesem Tag ist aber noch nicht vorbei. Weil ein Vorgesetzter ihn aufhält, kommt er auch noch fast zu spät zum Gottesdienst, obwohl er in der Kirche die Rolle des Platzanweisers hat. Als ihm auch noch in der Kirche ein Mißgeschick passiert und ihn die Amerikaner wie einen Verbrecher anstarren, flüchtet er und besinnt sich für seine Rache ob der erlittenen Schmach auf marshallesische Bräuche.
Währenddessen haben Jebro und Nuke einige Zeit auf Tar-Wōj verbracht und dort eine Schildkröte gefangen, die Jebro aber auf Nukes Wunsch wieder freiläßt. Später fahren sie zum Fischen hinaus und bewegen sich auch dabei in einem Gebiet, das sie eigentlich nicht aufsuchen dürfen. Dort treffen sie auf drei junge Amerikaner, die die Schule schwänzen um zu angeln. Die drei haben dem Bier schon mehr oder weniger reichlich zugesprochen, und einer der Jungs fühlt sich von den beiden Marshallesen so ausgetrickst, daß er mit einem riskanten Bootsmanöver eine Welle über sie schlagen läßt. Die Amerikaner entfernen sich dem Fischschwarm folgend, wenig später geht das Boot von Jebro und Nuke unter, weil es zuviel Wasser übernommen hat. Jebro versucht alles, um seinen kleinen Bruder zu retten, da er sich nicht vorstellen mag, seinem Vater ohne Nuke unter die Augen zu treten.
All dies wird beobachtet und auch beeinflußt von Gestalten aus der marshallesischen Mythologie, die in einem reichhaltigen und komplizierten Stammbaum angesiedelt sind. Während der Gott Etao dem Zwerg Ņoniep Streiche spielt, nähert sich die Mythologie und damit die Geschichte vor allem dieser beiden unaufhaltsam der Gegenwart, bis sie die Geschehnisse um Rujen, Jebro und Nuke berührt.
Meine Meinung: Recht selten bin ich von einem Roman so restlos begeistert, daß ich ihn sofort auf eine gedankliche Liste für eine zweite Lektüre setze. Und noch seltener könnte ich diese sofort anfangen, wenn ich das Buch gerade erst zugeklappt habe. Meļaļ ist einer dieser seltenen Fälle. Barclay packt viel in seinen Roman, der zudem nur an diesem einen einzigen Tag spielt, trotzdem wirkt die Story keinesfalls überladen.
Zum einen erfährt man viel darüber, wie die Amerikaner die Marshallinseln als Nukleartestgebiet mißbraucht haben, und welche Konsequenzen dies für die Marshallesen hatte: von der zwanghaften Umsiedlung auf wenige Inseln, über die Zerstörung alter Gemeinschaften und den fast vollständigen Verlust der eigenen Kultur bis hin zu körperlichen Mißbildungen und Erkrankungen auf Grund der Strahleneinwirkung. Dieses Thema ist kein Ruhmesblatt für die USA und – sofern überhaupt zur Kenntnis genommen – inzwischen vom größeren Teil der Welt wohl vergessen. Die Marshallesen werden auf einen Teil der Inseln beschränkt, selbst auf Kwajalein dürfen sie sich nur während der Arbeitszeiten aufhalten, werden sie nach Dienstschluß noch dort erwischt, behandelt man sie als Einbrecher. Was Barclay zudem über die Hygienebedingungen auf Ebeye durchscheinen läßt, sowie über die medizinische Versorgung, von der Bereitstellung allgemeiner Konsumgüter ganz zu schweigen (die Marshallesen dürfen nämlich nicht mal alles kaufen, was der Laden auf Kwajalein anbietet, nicht mal beliebige Socken), das hat mich mehr als einmal sprachlos und sogar wütend gemacht. Wenn ein Roman das schafft, dann ist das schon ziemlich gut.
Aber Barclay beschränkt sich nicht darauf, und deshalb ist es nicht einfach ein guter Roman, sondern ein außergewöhnlicher Roman. In diese Darstellung moderner Zeiten flicht er sorgfältig eine weitere Ebene, die sich aus der Mythologie der Marshallinseln speist. Immer wieder wird die Erzählung um Rujen sowie Jebro und Nuke durch Kapitel unterbrochen, in denen Götter, Zwerge, Dämonen und sonstige Wesen in ihrer Genealogie und ihrem mytholgischen Wirken vorgestellt werden. Dabei wirken sie ausgesprochen real, und vor allem den Gott Etao, ein ausgesprochenes Schlitzohr und eine Nervensäge obendrein, hätte ich schütteln mögen. Dieser Strang steht aber nicht losgelöst von dem modernen. Diese beiden Welten berühren sich zunehmend, überlappen sich gar, und welche Konsequenzen daraus für Rujen, seine Familie und die übrigen Bewohner Ebeyes resultieren – das war einfach nur faszinierend zu lesen. Spätestens dann klärt sich der Titel, der in Form eines Epigramms am Anfang erläutert wird als Meļaļ. Archaic. Playground for demons; not habitable by people. Und auch die drei amerikanischen Jungs sind am Ende des Tages nicht mehr die, die sie am Morgen noch waren, aber ihre Lektionen nehmen sie sehr unterschiedlich auf. Selbst das Ende fügt sich perfekt in diesen mythologischen Rahmen und hat mich sehr zufrieden zurückgelassen.
Vorne findet sich noch eine Karte, die die Atolle der Marshallinseln und in einer Ausschnittvergrößerung die Handlungsorte im Kwajalein-Atoll zeigt. So habe ich nur ein Glossar und/oder Nachwort mit einigen Erläuterungen zu den marshallesischen Wörtern und zur marshallesischen Kultur vermißt, aber das war wirklich nur ein kleiner Wermutstropfen, der den Gesamteindruck nicht mehr trüben kann.
![]() +
+ 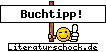
Schönen Gruß,
Aldawen

