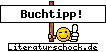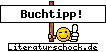Kaufen* bei
Amazon
Bücher.de
Buch24.de
* Werbe/Affiliate-Links
Klappentext:
Ein Mädchen allein, frierend, auf der Flucht. Hinter ihr liegen Hungersnot und die Brutalität der Menschen, unter denen sie aufgewachsen ist; um sie herum fremdes Land und seine Bewohner, die sie fürchtet, weil sie es so gelernt hat; vor ihr das Unbekannte.
Nordamerika im frühen 17. Jahrhundert: Englische Siedler, fromm, überheblich und fähig zur schlimmsten Gewalt, nehmen das Land in Besitz. Das Mädchen gehörte zu ihnen, doch nun ist sie allein. Die Wildnis ist hart, sie kämpft ums Überleben und beginnt, infrage zu stellen, was man ihr beigebracht hat. Haben die Menschen hier nicht ihre eigenen Götter, ihre eigenen Namen für die Dinge? Wozu brauchen sie die Europäer? Ist sie nicht selbst nur ein fremdes, zerbeultes Wesen in einer Welt, die ihrer nicht bedarf? Und während sie die Natur zu lesen lernt, wächst etwas Neues in ihr: ein anderer Sinn, eine Liebe, die nicht besitzergreifend ist.
Lauren Groffs Roman "Die weite Wildnis" beginnt mit der Flucht dieses zunächst namenlosen Mädchens in die Wildnis. Die LeserInnen können nur erahnen, was ihr zugestoßen ist, dass sie einen derart radikalen Entschluss fasst und verwirklicht. Denn zu den ohnehin reichlich vorhandenen Schwierigkeiten des Lebens in der Natur kommt, dass sie ausgerechnet im Winter flieht, was ihre Chancen auf das Überleben noch verkleinert.
Während man das Mädchen auf seinem Weg in die Wildnis begleitet, erfährt man nach und nach ihre Lebensgeschichte, die eine Geschichte von Erniedrigung und Unterdrückung ist, oft durch Männer, aber auch durch ihre bisherige Herrin. Letztendlich hat diese - mit einer unfassbaren Tat - auch den Anstoß dafür gegeben, dass das Mädchen mitten in der Nacht das Fort der Siedler verlassen hat und in den Wäldern ihr Leben riskiert. Da keiner der Namen, die man ihr im Laufe der Jahre gegeben hat, zu ihr passt, erscheint es auch folgerichtig, dass sie durch den ganzen Roman hindurch "das Mädchen" bleibt. Die einzigen wirklichen Freuden in ihrem Leben hat der Tod ihr genommen, das waren ihr Ziehkind Bess und ein namenlosen Matrose, der in seinem vorherigen Leben Glasbläser war. Besonders an sie denkt die Protagonistin in ihren verzweifelten Momenten.
Es gibt aber auch andere Momente in Lauren Groffs Roman. Die Natur ist hart und unerbittlich, schenkt dem Mädchen aber auch ihre Schönheit, gibt Nahrung, Trost und Zuflucht. Dies alles beschreibt die Autorin in einer wunderbaren Sprache, auch in den geschilderten grausamen Momenten. Und sie bleibt dabei ausgesprochen konsequent: in der Darstellung der Protagonistin, die eben keine Heldin ist, und in den Ausblicken auf das mögliche Ende des Romans, das ich als folgerichtig und passend empfunden haben.
Durch die beiden Erzählstränge, die miteinander verflochten sind, entwickelt der Roman einen Sog, denn man möchte unbedingt die Geschichte der Protagonistin erfahren, aber auch, wie es mit ihr weitergeht, schaut also immer wieder sowohl vorwärts als auch zurück. Die Naturbeschreibungen sind intensiv und sprachlich beeindruckend, sie passen zu der Geschichte und runden diese gekonnt ab.
Ich habe Lauren Groffs Roman an zwei Abenden hintereinander verschlungen und kann ihn an LeserInnen empfehlen, die sich für einen Abenteuerroman der anderen Sorte interessieren. Es ist kein typischer historischer Roman, es gibt keine HeldInnen und keine großen Ereignisse, aber gerade der Realismus und die kleinen Details dieses Romans machen ihn so lesenswert.